Die Geschichte interkultureller Paare – Wenn die Liebe stark ist
ROTHENBURG – Mit einer kleinen Weltgeschichte interkultureller Paare schließt sich in den Rothenburger Diskursen diese Saison der Bogen zu Themen der Interkulturalität, zu dem Nevfel Cumart im Oktober letzten Jahres den Anfang machte.

Wie Welt sich mischt: Michael Jeismann.
Von Spannungen, Krisen, aber auch geglückten Paarbildungen über kulturelle Grenzen hinweg wird der Historiker, Autor und Journalist Prof. Dr. Michael Jeismann am morgigen Freitag um 20 Uhr im Städtischen Musiksaal berichten. Ein Thema, das in einer globalisierten Welt gegenwärtiger nicht sein könnte.
„Glück und Unglück liegen nah beieinander, wenn zwei sich lieben, die aus verschiedenen Welten stammen. Ob Leila und Madschnun, Marlon Brando und Tarita Teriipaia, die Fee Peri Banu und der Prinz Achmed oder die kirchen- und regimekritische russische Pussy Riot Aktivistin Maria Aljochina und der ultraorthodoxe Dimitri Zorionow – ob Fiktion oder Wirklichkeit: Ihre Geschichten zeigen Blockaden an, deuten auf tief liegende Ängste und markieren historische Umwälzungen und Machtfragen.
Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: Da sollte etwa ein Beamter des israelischen Erziehungsministeriums untersuchen, wie viel jugendgefährdendes Potenzial der preisgekrönte Roman einer bekannten israelischen Schriftstellerin in sich berge. In dem Buch geht es um eine israelische Übersetzerin und einen palästinensischen Künstler, die sich in New York verlieben und eine Affäre beginnen.
Die Erzählung greift das Motiv unmögliche, verbotene Liebe auf. Jugendliche aber neigen zur Romantisierung und sind meistens nicht imstande, die Dinge von allen Seiten so zu betrachten, dass sie auch Aspekte wie die Bewahrung der Volksidentität und die Folgen einer Assimilation bedenken. So wurde der preisgekrönte Roman „Borderlife“ der israelischen Schriftstellerin Dorit Rabinynan zur Jahreswende 2016 von der Liste der für die Schulen Israels em-pfohlenen Bücher gestrichen.
Die Begründung ist universell und exemplarisch, unbeschadet der besonderen politischen Bedingungen, in denen sie formuliert wurde. Sie zeigt, wie ernst Staat, Gesellschaft und andere Autoritäten die bloße literarische Beschwörung einer interreligiösen und interethnischen Affäre nehmen können.
Die Abneigung gegen das „gemischte Paar“ wurde hier so auf die Begriffe gebracht, dass sie wie Kanonen auf die Liebenden und auf die Phantasie gerichtet sind. Verbotene Liebe, Romantisierung, Volksidentität, Assimilation: Der Gutachter hat in seiner Bewertung viel von dem versammelt, was diesen Paaren aus der Gesellschaft entgegenschlägt: Kollektive Ängste und Phantasmen, Verbote und Verlustgefühle. Und der Fall der israelischen Schriftstellerin steht nicht allein und stellt auch keineswegs die schärfste Reaktion dar. Die Beispiele hierfür lassen sich leicht vermehren, selten aber sind Aversion und Bedenken so präzise formuliert.
Das ‚gemischte Paar’ unterscheidet sich von anderen Paaren einmal durch die Bedenken und Ängste, die es auf sich zieht. Wie loyal sind diese Eingeheirateten, wie passen sie sich an? Dieses Misstrauen schlägt sich in der Gesetzgebung und in gesellschaftlichen Stimmungen nieder. Und sobald man meint, das eigene Gemeinwesen sei gefährdet, steht die Beziehung zu Fremden, die erotische zumal, unter Verdacht. Hinzu kommt, dass in der Paarbeziehung selbst Misstrauen und Entfremdung wachsen, sobald gesellschaftliche Konvention und Rollenverteilung die Liebenden in Konflikte mit ihrer Umwelt und sich selbst bringen. (…)

Das neue Werk erscheint zur Buchmesse.
Europa ringt mit sich. Um Offenheit und um Sicherheit. Um Integration und das Profil seiner inneren und äußeren Freiheit. Europa hat sich selbst zu behaupten in einer Welt, in der es gezwungen ist, sich zu verändern: Die Welt, in die es ausgegriffen hat, ist nun unser Nachbar. Wieviel Gleichheit gesteht man in dieser Situation zu?
In dieser Situation, in der sich Ansichten und Gegebenheiten einer Gesellschaft fundamental wandeln, werden Paare besonders aufmerksam beobachtet. Das war so, als in den sechziger Jahren das Modell der klassischen Paarbeziehung mit Heirat und Kleinfamilie nicht mehr unumstritten als Lebensideal galt. Und das ist nach wie vor so, wenn ein Partner aus der „Fremde“ stammt. Vormals relativ geschlossene Ordnungen des menschlichen Zusammenlebens haben sich aber unter dem Druck individueller Ansprüche und rechtlicher Grundsatzdebatten seitdem geöffnet:
Es wurde für legal erklärt, was lange verboten oder doch mit quälenden Prozeduren der Anerkennung verbunden war. Das Paar, das „gemischte“ oder „interkulturelle“ insbesondere, musste erfahren, dass sein Verhältnis an gesellschaftlichen Normen oder juristischen Vorgaben gemessen wird. Es ließ sich trotzdem nie ganz verhindern, dass sich solche Paare bildeten – sie sind die Dehnungsfugen im Gefüge einer Gesellschaft. Und ihre Geschichte ist die Geschichte unserer Freiheiten.
Michael Jeismann, geb. 1958, ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und Mitarbeiter des Goetheinstituts München. Er ist Spezialist für deutschfranzösische Geschichte, 2004 erhielt er den JeanAméry-Preis für Europäische Essayistik. Veröffentlichungen: „Wie die Welt sich mischt. Interkulturelle Paare von Sauskanu bis David Bowie“, „Auf Wiedersehen Gestern. Die deutsche Vergangenheit und die Politik von morgen“, „Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbild und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792 – 1918.“ Sein neues Buch „Die Freiheit der Liebe – Paare zwischen zwei Kulturen“ erscheint im Herbst zur Frankfurter Buchmesse. ch/sis





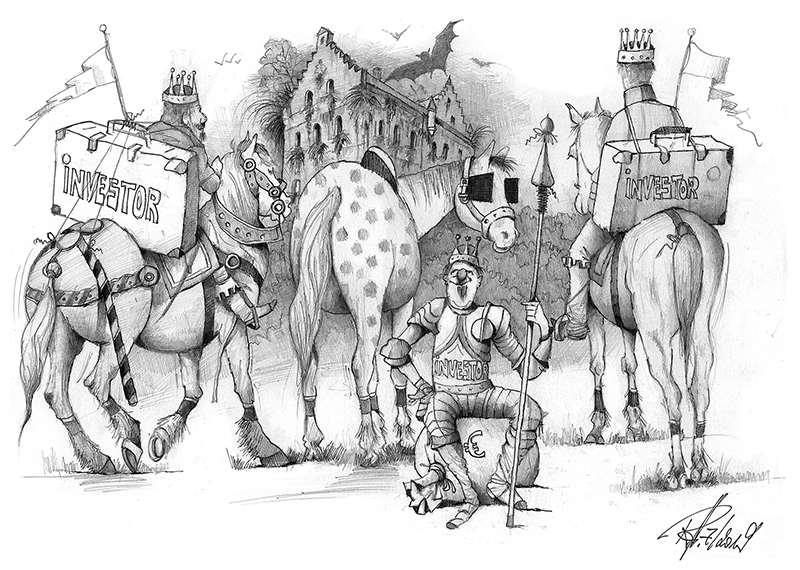
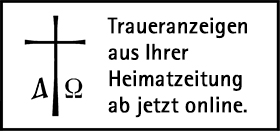

Schreibe einen Kommentar