Noch erinnern sich Zeitzeugen
An fünf Stellen in der Altstadt zehn Stolpersteine verlegt – Juden 1938 vertrieben
ROTHENBURG – „Das finde ich gut, dass man daran erinnert“ – diese aufgeschnappte erste Reaktion von Touristen auf die gestern verlegten Stolpersteine zeigt wie richtig es war das Vorhaben zu realisieren: wer sonst würde ahnen, dass in den schönen Häusern einst jüdische Mitbürger wohnten, die man vertrieben und letztlich ermordet hat? Dass sich in der Judengasse ganz überraschend ein Nachbar als einstiger Augen- und Zeitzeuge zu Wort meldete, gab dem Ganzen besondere Authentizität.
Pfarrer Dr. Oliver Gußmann begrüßte die zahlreichen Teilnehmer am Freitagmorgen um 9 Uhr vor der Herrngasse 21, der ehemaligen Synagoge, wo man mit der Stolpersteinverlegung begann. Das Gedenken war passend umrahmt von musikalischen Weisen und einem jüdischen Lied mit Flöten und Violine (Alexandra Geißler, Luisa Heindl und Theresa Strobl) sowie geprägt von der Mitwirkung zahlreicher Schüler vom Gymnasium und der Montessori-Schule. Sie lasen im Wechsel mit Erwachsenen die wichtigsten Lebensdaten der jüdischen Bürger und Familien vor.
Oliver Gußmann sagte eingangs, auch solange nach der schrecklichen Zeit des Dritten Reiches mache die Aktion Sinn, „weil das Eintreten gegen Rassismus und die Unterform des Antisemitismus eine ganz wichtige Aufgabe ist“. Man trete für den Frieden unter den Menschen ein, auch wenn sie „ganz anders sind als ich selber und ich mit ihren Lebensweisen nicht so zurechtkomme“ wie der Pfarrer wörtlich betonte.
Die drastische Zahl von sechs Millionen umgebrachten Menschen würde mit den Stolpersteinen stellvertretend individualisiert durch die Namensnennung vor den Wohnhäusern. Aber es gehe nicht allein um Juden, sondern auch Roma, Sinti und andere, die umgebracht wurden, könnten solche Stolpersteine erhalten, aber es fehle dazu noch an Informationen.
Allen, die an der Realisierung des Projektes mitgearbeitet haben, dankte der Geistliche und hob besonders die Stadt mit Oberbürgermeister Walter Hartl hervor. Dieser freute sich über die gute Beteiligung und erinnerte an die auch kontroverse Debatte im Stadtrat, aber es sei doch eine breite Mehrheit geworden.
Klar sei gewesen die Steine nur mit Einverständnis der heutigen Hauseigentümer zu verlegen, denn es gehe nicht darum Konfrontation zu schüren, sondern das Projekt auf einen guten Weg zu bringen. Dies bedeute auch, dass man weitere Steine noch später verlegen könne. OB Walter Hartl: „Ich hoffe, dass sich durch den heutigen Tag auch andere überzeugen lassen und ihre Bereitschaft erklären“. Durch die aktuellen Ereignisse habe die Aktion eine besondere Aktualität erhalten und sei umso wichtiger geworden verdeutlichte der Oberbürgermeister, dem das jüdische Andenken schon immer wichtig war. Der ausführende Künstler Gunter Demnig erinnerte an die Anfänge mit dem ersten Entwurf für Stolpersteine im Jahr 1993, aber erst ab 2000 lief das Projekt dann richtig an, heute sind über 500 Orte allein in Deutschland beteiligt. Nicht überall wolle man diese Steine, sagte Demnig: der Oberbürgermeister von Pirmasens habe abgelehnt mit der Begründung, das hätten schon zu viele und man sei ja nicht der erste.
Doch darum gehe es ja nicht, von Trondheim über Rotterdam und Rom bis zur Ukraine, neu auch Kroatien und Russland würden in dreizehn Ländern Stolpersteine verlegt. Demnig zum tiefen Sinn: „Du musst vor dem Opfer eine Verbeugung machen“. Nach Musik und dem Verlesen der Namen und Schicksale durch Schüler ergriff Erich Landgraf als Pate eines Stolpersteines das Wort. Er sei Jahrgang 1935 und habe als früheste Erinnerung das Bild eines alten Mannes vor sich, in Unterhosen abends vor einer Menschenmenge und die Szenen, als er in seiner Heimatstadt Weimar mit Kameraden Kupfermünzen auf Bahnschienen gelegt hat, um zu beobachten wie sie platt gefahren wurden. Landgraf: „Diese Züge transportierten Häftlinge nach Buchenwald und mir ist das Bild wie Menschen aus mit Stacheldraht vergitterten Fenstern blickten gegenwärtig, die Häftlinge in gestreifter Kleidung waren auch bei Arbeiten zu Kriegsende präsent unter strenger Bewachung mit Karabinern und Hunden.“ Diese Erinnerungen werde er nicht los sagte Erich Landgraf und er sei froh, dass man nun in Form dieser Steine in Rothenburg gedenke.
Nach dem offiziellen Auftakt machten sich die meisten noch mit auf den Weg zu den insgesamt fünf Wohnorten und Verlegungsstellen in der Altstadt. Künstler Gunter Demnig nahm die Verlegungsarbeit mit Unterstützung von Handwerkern des Bauamtes vor, wobei man ganz bewusst erst vor Ort das Pflaster aufbrach und das nicht vorbereitet hatte. Jede Pflastersteinverlegung war begleitet von stimmigen Lesungen. So verlasen zum Beispiel Montessori-Schüler das „El male rachamim“ als Anfangsworte eines jüdischen Gebets, das am Todestag eines Verstorbenen üblich ist. Bei der Steinverlegung in der Judengasse 22 kam aus der nächsten Nachbarschaft zwei Häuser weiter der Schuhmacher Willi Ott zur Stolpersteinverlegung und ergriff spontan das Wort.
Als siebenjähriger Junge hatte er 1938 mit seinen Eltern erlebt, wie Rosa und Sigmund Hamburger vertrieben wurden (Arno Hamburger in Nürnberg ist ein Großneffe). „Das waren Leute wie wir, Frau Hamburger hat in unserem Hof die Wäsche aufgehängt, es gab nie Probleme und die andere Nachbarin Frau Abelein war sehr christlich und hat den Hamburgers immer wieder mal was gegeben, worauf sie sogar eingesperrt wurde“, erinnert sich Willi Ott. „Ich habe das Geschrei noch in den Ohren, als man damals die Nachbarn abholte“, sagte der Rothenburger. Der Glaube dürfte doch keine Rolle spielen, mahnte Willi Ott, aber leider habe sich bis heute nichts geändert.
Die Namen auf den Steinen in der Herrngasse 21: Ida und Samson Wurzinger, Sigmund und Bella Lissberger. In der Kirchgasse 1: Jonas Gottlob und in der Judengasse 22 Rosa und Sigmund Hamburger. Helene und Sigmund Kirschbaum in der Neugasse 34 sowie Siegfried Steinberger in der Oberen Schmiedgasse 15. Alle haben einen Paten gefunden, der die Stolpersteinkosten übernommen hat. Die meisten der genannten jüdischen Mitbürger wurden in den Lagern Theresienstadt oder Auschwitz ermordet. Mit den Stolpersteinen hat der unbegreifliche Vorgang eines organisierten Massenmordes des NS-Regimes in Rothenburg ein Gesicht bekommen. Mit Psalm 115 („Der Herr segnet uns“) schloss Pfarrer Gußmann. diba
Kurz kommentiert:
Kein Schlussstrich
Einen Schlussstrich kann man vielleicht nach längerer Zeit unter Kriegen ziehen wie sie die europäischen Staaten Jahrhunderte lang als gottgegeben erleben mussten – niemals aber unter einer solch unglaublichen Tat wie dem staatlich perfekt organisierten Massenmord an den Juden, wobei sich unser Volk auch eines Teils seiner Intellektuellen (Künstler, Autoren, Wissenschaftler) entledigt hat. Manche Juden harrten bis zuletzt aus, weil sie als nationalgesinnte Deutsche fühlten, Ritterkreuzträger darunter: „Uns können sie doch nicht holen“ wurde vergeblich gehofft.
Erste Reaktionen von Passanten zeigen, dass die namentliche Erinnerung an die vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger durch Stolpersteine den gewünschten Effekt hat. Tief berührt haben die Worte von Schuhmachermeister Willi Ott, der die Schreie nebenan hörte, als man die Hamburgers vertrieben hat. Und die Erinnerungen des Weimarers Erich Landgraf an die ausgemergelten Häftlinge hinter Stacheldrahtfenstern der Züge nach Buchenwald. Der Antisemitismus sitzt tief, bis heute spürbar. Der Jugend muss das Unbegreifbare nahegebracht werden als Mahnung alles dafür zu tun, dass sowas nie mehr geschieht. diba




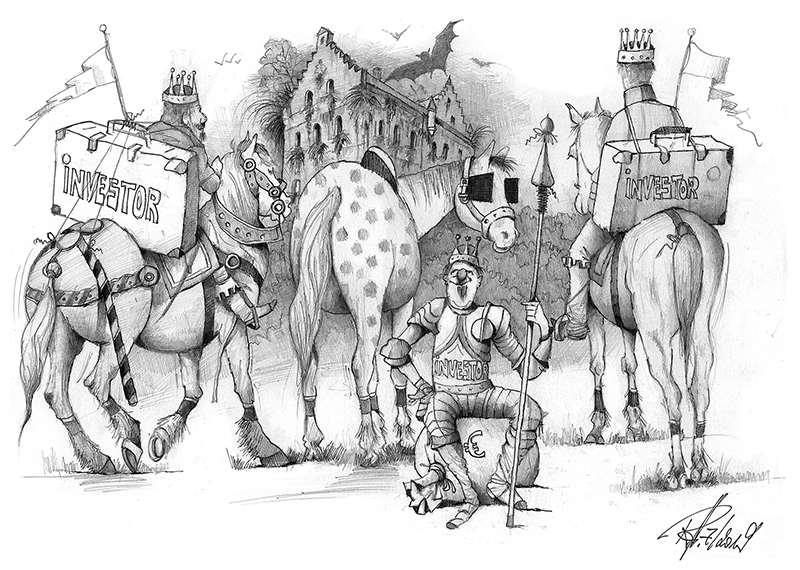
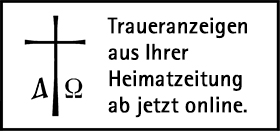

Ich selber habe mit geholfen die Daten für die Stolpersteine zu sammeln und bin der Meinung das dies schon viel früher in Rothenburg hätte geschehen müssen. Aus diesem Grund haben wir, der Abschlussjahrgang des RSG auch mitgeholfen und das Projekt unterstützt. Denn viel zu wenig Menschen machen sich Gedanken darüber, was im dritten Reich passiert ist. Obwohl genau das auch heute noch wichtig ist, um eine Wiederholung dieser schlimmen, grausamen, menschenverachtenden Zeit zu verhindern!!
Sorry,
man (ich) sollte solche Berichte bis zum Ende lesen und nicht beim ersten Bild aufhören. Selbstverständlich ist mein Eintrag vollkommen fehl am Platz.
Nicht nachvollziehbar ist das wilde Parken von motorisierten Hinterbänklern, auf dem ansonsten mit eingeschränktem Halteverbot belebten Marktplatz…der Untertan lässt grüssen!
Diese sogenannten „Stolpersteine“ werden im Rheinland schon seit etlichen Jahren in gleicher Weise z.B. in Neuss eingesetzt. Es ist also keine Erfindung aus dem Frankenland.
Sehr geehrter Herr Breuer,
natürlich sind die Stolpersteine keine Erfindung aus dem Frankenland. Dass sie bereits seit 1993 und inzwischen in über 500 deutschen Städten durch Gunter Demnig verlegt wurden, wird im Artikel deutlich erwähnt.