Toppler wieder hier!
Kulturkritik: Großer Applaus für eine überzeugende Premiere
ROTHENBURG – Wo Toppler draufsteht, da sollte auch Toppler drin sein! In diesem Sinne setzte Autor und Regisseur Reiyk Bergemann (assistiert von Franziska Krause) jüngst zum zehnjährigen Jubiläum der Theatergründung sein Stück „Toppler oder der Versuch, sich die ganze Welt untertan zu machen“ zum dritten Mal in Szene.

Starkes Trio: Thomas Karl Hagen, Matthias Klösel, Adelheid Bräu (v. l.). Foto: Pfitzinger
Es ist nach der Premiere 2008 und einer leicht modifizierten Fassung von 2009 eine gelungene Version, die ihren besonderen Glanz freilich der beeindruckenden Ensembleleistung verdankt. Das volle Haus dankte mit herzlichem Beifall für über zwei Stunden fesselnd anspruchsvolle Bühnenkunst.
Die Grundstruktur des quasi einaktigen Aufzugs (mit Pause) ist ähnlich geblieben: Zwei Schauspieler und eine Schauspielerin proben ein „Toppler-Stück“. Dabei verschmelzen sie immer wieder wie in einer Zeitmaschine mit ihren historischen Spielfiguren. Wenn sie in der Jetzt-Zeit auftauchen, sprechen sie sich an mit ihren wirklichen Namen und warten auf Regisseur Reiyk Bergemann, der wohl im „Güldenen Greifen“ – dem einstigen Wohnhaus Heinrich Topplers – sitze mit ausgeschaltetem Handy. Der Historiker Dr. Ludwig Schnurrer wird zur Lektüre empfohlen in Sachen Fachwissen – das heimische Publikum schmunzelt ob der mit angenehm lockerer Hand eingestreuten lokalen Bezüge.
Überhaupt: Humor mit Tiefenschärfe durchpulst das Stück bis ins Detail: So sind einige Schachfiguren auf dem Tisch eine symbolträchtige Mischung aus Fläschchen, gefüllt entweder mit homöopathischen Globuli oder Likör – augenzwinkernde Hilfsmittel, um Lebens- schachzüge zu tätigen.
Denn der legendäre Rothenburger Bürgermeister hat wahrlich Probleme. Thomas Karl Hagen gibt ihn als schillernden Unsympathen, harsch ambitioniert oder schmeichlerisch umgarnend, je nach Kalkül. Macht im reichsstädtischen Territorium und Besitz, das sind seine Leidenschaften. Toppler „trump“elt auf den Gefühlen selbst seiner engsten Vertrauten herum oder lässt gar Ursula von Seckendorff, die Äbtissin des Dominikanerinnenklosters und ihre Ordensschwestern brutal verjagen.
Als sei sein Motto „Rothenburg first!“, attackiert er nicht nur Gegner außerhalb der Stadt, sondern sogar den eigenen Schwager Peter Nordheimer oder den Patrizier und Weinhändler Hans Wern. Ein überdimensionales Schwert, ein riesiges Kreuz zum Gehstock degradiert dienen in der Inszenierung als hintergründige Symbole für Machtanmaßung.
Matthias Klösel, der in den früheren Aufführungen den Toppler spielte, wirkt in seiner Mehrfachrolle souverän; gelöster, noch präsenter als vor Jahren. Auch er nutzt die klug ausgedachten Utensilien des Bühnen- und Kostümbilds (ausgezeichnete Arbeit von Valerie Lutz im Zusammenspiel mit künstlerisch bedachten licht- und tontechnischen Effekten von Harald Köhler) in mitreißender Komik. So fungiert bei Klösel eine Stoffhenkeltasche als verblüffend kleidsame Kopfbedeckung eines reitenden Boten.
Ein Glücksgriff besonderer Güte: Adelheid Bräu, eine schlichtweg fabelhafte Volksschauspielerin mit einer auch in zartfeinen Farben bestens ausgestatteten Palette. Auch sie hat viel zu tun als Multicharakter: vom genialisch wie nervenbohrend besoffenen König Wenzel bis zu den Ehefrauen und klerikalen Gestalten des Stücks. Wenn sie mit franz-josef-strauß-artigem Auf- und Abwippen und herzschwach pfeifendem Atem als Magister einen schweren Fall von Ketzerei diagnostiziert, dann prustet man nur leise vor Lachen, um nichts zu verpassen.
Kein leichter Stoff! Aber „schwer ist leicht was“, das sagte schon Karl Valentin. Sehenswert! bhi



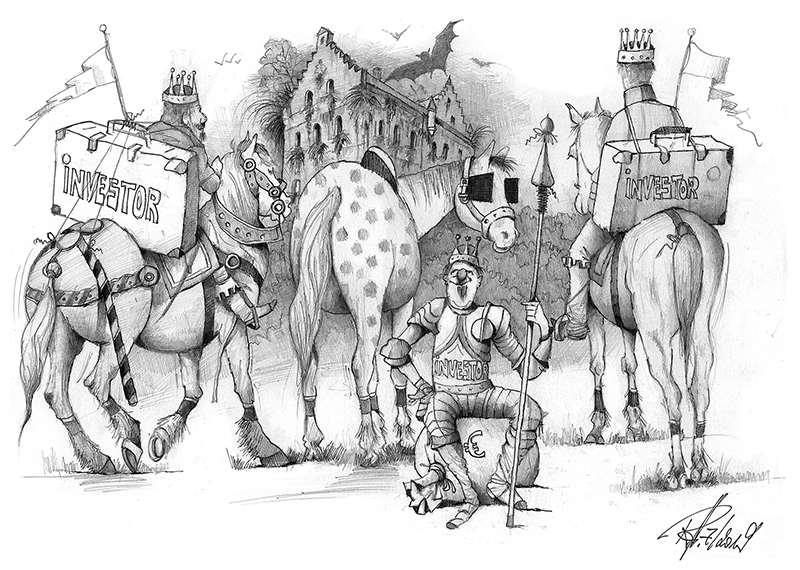
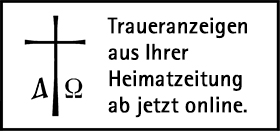

Schreibe einen Kommentar