Reich differenzierte Baukultur
Landesweite Fachtagung zur Hausforschung – Rothenburg beeindruckte
ROTHENBURG – Rund siebzig Vertreter des Arbeitskreises für Hausforschung in Bayern kamen am Wochenende zu ihrem Jahrestreffen in der Rothenburger Johanniterscheune zusammen. Fachvorträge und Exkursionen gehörten zum Programm. Deutlich wurde dabei, dass es ausgerechnet im mittelalterlichen Rothenburg vor 1945 keine Hausforschung gegeben hat. Dabei ist diese für die Stadtgeschichte von enormer Bedeutung.
Der erste Tag war ausschließlich dem baulichen Erbe der Stadt gewidmet: Die Themen der Fachvorträge reichten von archäologisch ergrabenen Spuren (Horst Brehm) über Einzelbauten wie das Rathaus (Dr. Karlheinz Schneider) und das sogenannte „Hegereiter-Haus“ (Silke Walper-Reinhold) bis zu einer ausführlichen Zusammenschau prägender Merkmale von Rothenburger Architektur (Professor Konrad Bedal).
Im Rahmen des Programms wurde nicht zuletzt durch den Beitrag von Architekt Eduard Knoll deutlich, welch großer Schatz an qualitätvoller historischer Bausubstanz seit dem 13. Jahrhundert die Stadt auch heute noch aufzuweisen hat. Dabei ist die Bedeutung von Fotos der zerstörten Gebäude hervorzuheben, auf deren Grundlage wichtige Einzelheiten zur Stadtgeschichte zu ermitteln sind. Es wäre wünschenswert, wenn für Rothenburg die noch vorhandenen Fotos aus Privatbesitz an zentraler Stelle zusammengetragen würden wie man auf der Tagung feststellte. Darüber hinaus seien nicht alleine die im Wiederaufbau der Nachkriegszeit erhaltenen Reste früherer Jahrhunderte von Interesse, sondern auch die Leistungen des Wiederaufbaus in den fünfziger Jahren selbst.
Drei Exkursionen mit Besichtigungen von Rathaus, Fleischhaus, Ratstrinkstube, Hegereiterhaus und weiteren Bauten veranschaulichten den Teilnehmern unmittelbar, dass über stereotype Vorstellungen, die von touristischer Vermarktung geprägt werden, hinaus ein viel größerer, imposanter Schatz an Beispielen historischer Baukultur in der Stadt überdauert hat.
Der Samstag war mit sieben Vorträgen, die Themen in Bayern und darüberhinaus zum Inhalt hatten, dicht bestückt und wie der Freitag schon sehr gut besucht. Die Spanne der Vorträge reichte von Dachwerken des 14. Jahrhunderts über illusionistische „Holztapeten“, Küchen mit gepunkteten Wänden und Decken bis zu historischen Methoden der Wärmedämmung.
Wie die Veranstalter Georg Waldemer (Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen), Dr. Herbert May (Freilandmuseum Bad Windsheim) und Ariane Weidlich (Freilichtmuseum an der Glentleiten) zusammenfassend bewerten, zählte zu den wichtigsten Effekten dieses Fachtreffens, „dass manch gängiges Vorurteil über den Denkmälerbestand in Rothenburg in Frage gestellt wurde“. Gleichzeitig habe der interessierte, „ja staunende Blick auf die imposante und reich differenzierte Baukultur der ehemaligen freien Reichsstadt neue Perspektiven eröffnet“. Dabei war die Hausforschung hier lange ein Stiefkind.
Wie Prof. Dr. Konrad Bedal in seinem Überblick feststellte, gab es erst nach dem Krieg erste Arbeiten zur Hausforschung. Dann seien es die Untersuchungen von Eduard Knoll, Michael Kamp und eine Masterarbeit über den Wiederaufbau gewesen sowie aktuell die Doktorarbeit von Karlheinz Schneider über den Renaissancetrakt des Rathauses – aber noch immer fehle es an umfassenderen Beiträgen zum älteren Baubestand. Das sei „ein großes Mißverhältnis” zur historischen Bedeutung der Stadt. Bedal machte deutlich, dass Rothenburg zu unrecht „in gewissen Kreisen als Touristenstadt verrufen ist“. Trotz der Teilzerstörung zu rund vierzig Prozent sei bis heute wesentliche Bausubstanz erhalten wie der Referent auch anhand von zahlreichen Dias aufzeigte. Vor allem die Herrngasse und der Marktbereich zeige hervorragende Beispiele.
Vieles an Kostbarkeiten ist im Innern versteckt, wozu Holz- und Steinkonstruktionen ebenso gehören wie wertvolle geschnitzte Säulen oder ein Dachwerk von 1346. Natürlich durfte der Hinweis auf das 1959 publizierte Standardwerk von Anton Ress über kirchliche Bauten in Rothenburg nicht fehlen. Heute gilt es zu dokumentieren, was noch da ist. Erstmals hatte Dr. Markus Hirte als der neue Museumsleiter Gelegenheit eine Veranstaltung in der Johanniterscheune zu eröffnen.
Der angekündigte Generalkonservator Prof. Dr. Egon Greipl konnte aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen. Die Stadt war durch Bürgermeisterin Irmgard Mittermeier vertreten, die auf Rothenburgs Baukultur und den „einzigartigen Wiederaufbau“ nach der Kriegszerstörung verwies. Man sei sich der Verpflichtung zur Bewahrung des historischen Erbes bewusst und investiere allein 2013 mehr als 1,3 Millionen dafür. Auch private Hausbesitzer seien hier ständig gefordert. diba/eb




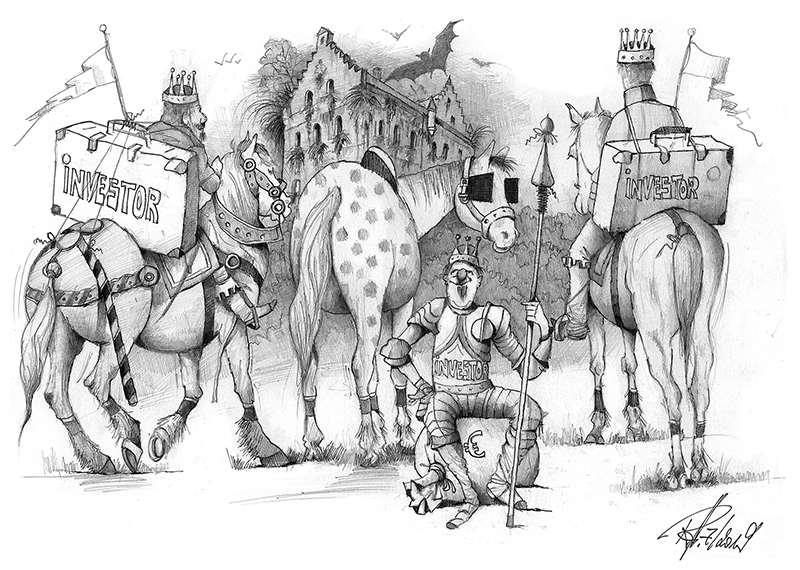
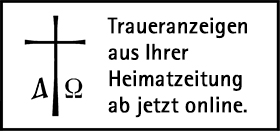

Schreibe einen Kommentar