Rothenburg zwischen Rettung und vollständigem Untergang – Premiere des Dokumentarfilms
ROTHENBURG – Mit dem mit 15000 Euro dotierten Marion-Samuel-Preis für die Dokumentarfilmgruppe der Oskar-von-Miller-Realschule ehrt die Stiftung Erinnerung des Ehepaares Walther und Ingrid Seinsch 35 Jahre historische Aufklärungsarbeit quälender Erlebnisse während der NS-Zeit in der Region. Die Auszeichnung wird im Herbst in Augsburg verliehen und soll für Thilo Pohle und seine Filmschüler Ansporn für weiteres Engagement sein, dass erlittenes Unrecht nicht vergessen wird.

Dieter Kölle, Thilo Pohle, Stiterin Ingrid Seinsch und Benjamin C. Jones (v.l.). Fotos: sis
Der neue Dokumentarfilm über die Kapitulation der Stadt Rothenburg hatte am Montagnachmittag Premiere im vollbesetzten Rokokosaal des Wildbades. Vor 73 Jahren hatten am gleichen Ort und zur gleichen Zeit die geheimen Verhandlungen mit den Amerikanern im kriegszerstörten Rothenburg stattgefunden. Ein brisantes Unterfangen, um zu verhindern, dass die Stadt nach der Bombardierung am 31. März 1945 nicht völlig in Schutt und Asche gelegt wurde.
In dem neuen Film entstand im Zusammenwirken von verschiedenen, sehr bewegenden Ezählungen von Zeitzeugen und zahlreichen Dokumenten vor allem aus amerikanischen Archiven ein Bild von der Rettung der Stadt, das überraschte. Dass die Stadt kampflos übergeben werden konnte, verdankt Rothenburg einer Reihe von Bürgern, die das hohe Risiko eingegangen sind, noch in der Anwesenheit von deutschen Soldaten Kontakt mit den Amerikanern aufzunehmen.
Alle Rothenburger wussten, dass SS-General Max Simon mit seinen sinnlosen Hinrichtungen von „Verrätern“ auf seinem Weg durch ganz Franken eine Spur des Todes gezeichnet hatte. Längst führte er seinen ganz persönlichen Krieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Die Recherchen haben ergeben, dass SS-General Max Simon nicht der Retter der Stadt war, wie in den Nachkriegsprozessen zu Brettheim seine Verteidiger dies immer wieder behaupteten und die Richter kritiklos hinnahmen. Was dazu beitrug, dass Simon dreimal freigesprochen wurde.
Die Erklärung des US-Generals Jakob Devers und der Brief des Unterstaatssekretärs im Kriegsministerium, John Jay McCloy an den Künstlerbund von 1948 weisen auf McCloys Mitwirken bei der Rettung der Stadt hin. Noch entscheidender war aber, dass die amerikanischen Kampfeinheiten, die vor Rothenburg standen, die Übergabegespräche tatsächlich durchführten, obwohl immer noch deutsche Soldaten in der Stadt waren.
Christian Probst aus Rothenburg verdankt die Filmgruppe den Hinweis auf das Buch des US-Korrespondenten William Dwyer „So long for Now“ in dem er die Annäherung der amerikanischen Truppen der 4. US-Infanteriedivision am 16. April 1945 in Rothenburg beschreibt. Seine Schilderungen zeigen, dass diese Operation lebensgefährlich war. Die Mission sollte exakt drei Stunden dauern – und würden die amerikanischen Parlamentäre nicht pünktlich zurück sein, würde die Stadt aus der Luft und mit Artilleriefeuer angegriffen. Der Film gibt eindrücklich die Situation wider, die immer kritischer wurde, vor allem, als die Amerikaner ihre Augen verbunden bekamen und alle sechs zu einem offenen deutschen Fahrzeug geführt wurden. Sie befürchteten, exekutiert zu werden. Bei der Fahrt durch die Stadt zum Wildbad zeigten ihnen Leute am Straßenrand die Faust und spuckten aus. Die Amerikaner fühlten sich ungerecht behandelt: „Sie nennen uns Schweinehunde. Und wir sind hier, um ihre gottverdammte Stadt zu retten.“
Eindrücklich führt der Film vor Augen, wie ein Wettrennen mit der Zeit begann. Die deutschen Wehrmachtsoffiziere suchten sich für einen eventuellen Abzug aus der Stadt bei ihren Vorgesetzten bis nach Nürnberg abzusichern, sahen aber auch, dass buchstäblich in wenigen Minuten die Beschießung der Stadt möglich war. Zu ihrem Glück war zu der Zeit der SS-General Max Simon in Feuchtwangen mit der Vorbereitung der Verteidigung Crailsheims befasst. Deshalb wagten die Wehrmachtsoffiziere den Abzug der Truppen aus Rothenburg vorzubereiten. Die Bevölkerung litt unter der „totalen Unsicherheit“, was die Amerikaner mit der Stadt vorhatten, denn die Verhandlungsergebnisse vom Wildbad blieben zunächst geheim. Auch der Abzug der Truppen erfolgte „in aller Stille“. Der damalige Stadtamtmann Hans Wirsching machte sich durch heimliche Kanäle kundig.

Einer der Zeitzeugen im Film: Kurt Melzner.
Augen- und Zeitzeugen in dem Dokumentarfilm vermitteln alles das, was sie erlebt haben und nicht in den Geschichtsbüchern steht. Sie wandern zwischen der Vergangenheit in die Gegenwart hinein und haben eine ganz eigene Sicht auf die erlebten Ereignisse. Wie der damals 14-jährige Hitlerjunge Kurt Melzner, der die Aufgabe hatte, die Flugwarnungen abzuhören. Ernst Geißendörfer war durch seine vielen Amerika-Kontakte ein guter Ansprechpartner für die Parlamentäre, auch Georg Pirner vom „Eisenhut“ mit seinem perfekten Englisch. Nicht nur Rothenburger, auch zahlreiche Evakuierte, die der Ablauf des Krieges nach Rothenburg geführt hat wurden in den letzten fünf Jahren unter Mitwirkung der Filmschülerinnen und Filmschüler (Josua Berger, Aylin Ertop, Günther Etter, Michael Hanselmann, Andrea Knäulein, Anastasia Kühlwein, Kerstin Schmidt) befragt und ihre Aussagen niedergeschrieben.
Kerstin Schmidt aus Stettberg ist seit 2004 in der Filmgruppe aktiv und hat beim neuen Film zusammen mit Thilo Pohle Regie geführt. Sie hat über all die Jahre hinweg als Schnittmeisterin und Filmemacherin den Überblick über das umfangreiche Filmmaterial behalten. Der inzwischen verstorbene Lehrer Harald Schelter zeichnete sich für die Filmmusik verantwortlich.
Groß ist der Kreis der Zeit- und Augenzeugen: Darunter Erika Bohn, Klara Baierlein, Hannes Centmayer, Karl Friedlein, Lore Gerlinger, Erich Heißwolf, Dr. Hanno Heller, Sigrid Heller-Meyer, Grete Hepp, Traudl Hufnagel, Helmut Keitel, Hermann Klenk, Lore Klingler, Emmi Knörzer, Günther Korn, Maria Köhnlein, Gertrud Schubart, Wilhelm Löblein, Heinz Triftshäuser, Richard Gerstmeyer, Helmut Keitel, Rosa Schwab. Mehr als in allen vorangegangen Filmen prägen in dem neuen Dokumentarfilm amerikanische Militärberichte und Quellen die Ereignisse. Die Filmgruppe verdankt dieses Material vor allem Andrea Krauß-Gonzales und ihrem Mann, die im Nationalarchiv in Washington umfangreiche Recherchen durchgeführt haben. Dass auch im neuen Film Jugendliche gemeinsam mit der Großelterngeneration die Geschichte erzählen, ist inzwischen ein Merkmal der Dokumentarfilmgruppe.
Thilo Pohle dankte der Realschulleitung und dem Landkreis, dass sie die Arbeit seit 35 Jahren unterstützen. Sein Dank galt auch der Sparkasse, dem Wildbad und der Stiftung Erinnerung. Breite Unterstützung erfährt die Filmgrupe auch aus den Reihen der Bevölkerung. Durch die Vermittlung von Günther Schuster als Präsident der deutsch-amerikanischen Gesellschaft Mittelfranken hat die Filmgruppe auch Kontakte zu amerikanischen Historikern und zur amerikanischen Armee. Seine exakten Übersetzungen waren die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit den USA.
An der Premiere im Wildbad nahm auch der US-Standortkommandeur, Oberst Benjamin C. Jones, teil. Der Brettheim-Film in englischer Sprache wurde kürzlich in der amerikanischen Garnison in Katterbach vorgeführt. Die dramatische Dorfgeschichte in der Umgebung von Rothenburg war vor 35 Jahren der Ausgangspunkt für die Arbeit der Filmgruppe und wurde inzwischen von Moskau bis San Francisco vorgestellt.
Der neue Film setzt das jahrzehntelange Engagement fort. Es wurde mit stehendem Applaus gewürdigt. Die Auszeichnung sei verdient, war die einhellige Meinung. Als Träger des Marion-Samuel-Preises gehört die Dokumentarfilmgruppe zu einem Kreis internationaler Persönlichkeiten wie Michael Verhoeven, Vladimir Danovsky, Imre Kertész, Wolf Biermann, Götz Aly die Geschichten als Mahnung für die Gegenwart wachhalten. Der neue Dokumentarfilm ist vom 23. bis 27. April täglich um 19 Uhr und am 28. April um 15 Uhr in der Oskar-von-Miller-Realschule zu sehen. sis





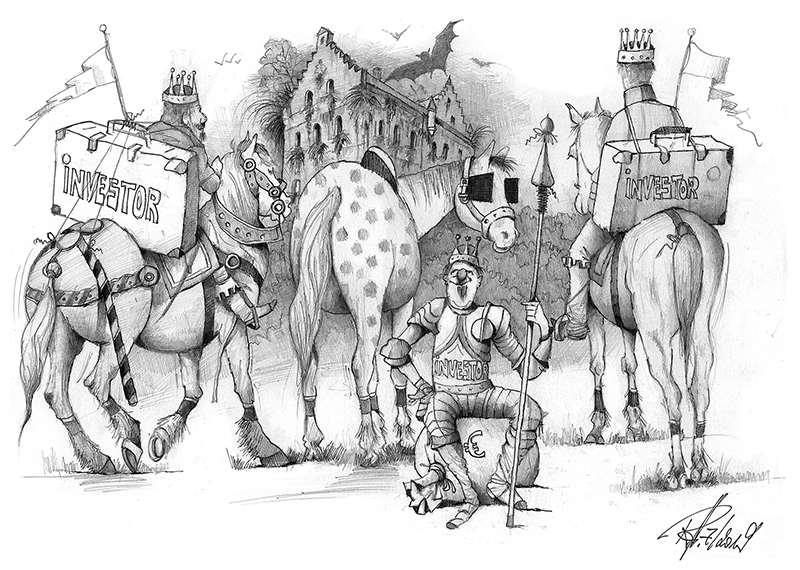
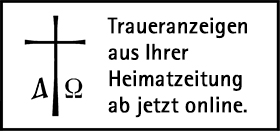

Schreibe einen Kommentar