Schuld gegen Schuld abwägen
Der Theologe Wolfgang Huber über Bonhoeffers Ethik und Widerstand
ROTHENBURG – Eine ebenso kundige wie spannende Lehrstunde in Sachen klarer Sprache und Einschätzungen des evangelichen Theologen Wolfgang Huber zum Widerstandskämpfer des NS-Regimes, Dietrich Bonhoeffer, erlebten kürzlich rund 120 Zuhörer in der Rothenburger Buchhandlung Rupprecht.

Die Anziehungskraft der Veranstaltung zeigte sich im guten Besuch der Buchhandlung. Fotos: Schäfer
In geschliffenen Worten konkretisierte die markante Persönlichkeit der Evangelischen Kirche die Bedeutung von Bonhoeffers Pazifismus für die christliche Friedensethik. Wolfgang Huber hat in seiner sechsjährigen Amtszeit als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands das öffentliche Ansehen des Protestantismus gestärkt und sich dem Wettbewerb mit Katholiken, Muslimen und Atheisten gestellt.

Markant und prägnant: Wolfgang Huber.
Der mittlerweile 76-Jährige hat über eine große Zahl theologischer und ethischer Themen gearbeitet. Wichtige Anregungen verdankt er der Theologie Dietrich Bonhoeffers; die Neuausgabe von Bonhoeffers Werken hat er federführend verantwortet. Der gebürtige Straßburger hat früh angefangen, sich mit dem Theologen Dietrich Bonhoeffer zu beschäftigen: „Er wurde ein Teil meiner eigenen Biografie und Theologie.“
Die Suche nach Wahrheit
Gerade hat Wolfgang Huber ein neues Buch über den Widerstandskämpfer veröffentlich, das im Münchner Beck-Verlag erschienen ist mit dem Titel „Dietrich Bonhoeffer – Auf dem Weg zur Freiheit“. Darin hat er das Verhältnis zwischen Biografie und Theologie Bonhoeffers intensiv beschrieben, die Ernsthaftigkeit seiner Suche nach Wahrheit, die Intensität, mit der er zeitlebens Theologe gewesen ist. Auch in der dramatischen Zeit des Widerstands, als er ein Teil der militärischen Abwehr war und unter diesem Dach konspirativ gegen Hitler agierte und diejenigen unterstützte, die dann das Attentat auf den Führer vorbereiteten. Und dass er in dieser Zeit gleichzeitig beharrlich und kontinuierlich an einem theologischen Manuskript über Ehtik arbeitete.
Bonhoeffers Lebensthema war die Kirche – nicht die Religion. Dies gilt sowohl im Blick auf seine Theologie wie auch im Blick auf seine Existenz. Er betonte immer wieder die Verantwortung für seine Mitmenschen und die Wichtigkeit „wirklichkeitsgemäßen Handelns.“ Seinen Zugang zur Kirche fand Bonhoeffer in der Welt. Als Student stieß er in den 1920er Jahren in Tübingen, New York und Rom auf das Thema Ökumene. Damals lehnten die Kirchen ein Miteinander der Konfessionen ab. Zugleich lernte Bonhoeffer christlichen Pazifismus kennen. Dies weckte seine Kritik an der Staatsnähe deutscher Kirchen.
Als junger Dozent erlebte er in Berlin, wie Studenten seine Verlesung verließen, weil er den nationalen Aufbruch und die „Rassepolitik“ ablehnten. Bonhoeffer hatte 1932 mit der Vorstellung eines „gottgewollten Krieges“ gebrochen. Er forderte seine Kirche auf, „den Frieden als Wagnis“ zu verstehen. Bonhoeffers Pazifismus sei aber kein „prinzipeller Pazisfismus“, der um die Gewaltlosigkeit willens den Gewalttäter gewähren lässt, so Wolfgang Huber. Auch heute gebe es „Grenzsituationen“, in denen Gewalt nur mit Gegenwalt zu stopppen sei. So dürfe man den Terror des „Islamischen Staats“ und seiner Ableger nicht tatenlos hinnehmen.
Bonhoeffer zog mit seiner Bereitschaft, an der Planung des Attentats auf Hitler mitzuwirken, allerdings ohne Waffen, sondern als „getarnter Kurier des Widerstands“, selbst die praktischen Konsequenzen aus seinen theologischen Maximen. In seiner Bereitschaft zur Schuldübernahme, als die Tötung eines Menschen geplant wurde, blieb er trotzdem seinem Engagement für die Überwindung aller Gewalt treu. Dem Rad gewaltfrei in die Speichen zu fallen, war für ihn Priorität.
Im Widerstandskreis der Bekennenden Kirche gab es einen Streitpunkt: Sollen alle Akten vernichtet werden, damit die Beweise vor der SS verschwinden? Oder müssen die Dokumente aufbewahrt werden, um den Alliierten bei Kriegsende die Widerstandsbewegung zu belegen. Bonhoeffer war der Meinung, dass zur Sicherheit der Widerstandskämpfer keinerlei Material aufbewahrt werden dürfte. Doch man blieb sich in diesem Punkt uneins und so fand die SS am 5. April 1943 bei Bonhoeffers Schwager Hans von Dohnanyi belastende Unterlagen. Später stießen sie auf Beweise, die Bonhoeffers Beteiligung am gescheiterten Hitler-Attentag vom 20. Juli 1944 belegten.
Nach den anderthalb Jahren im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Tegel hatte Bonhoeffer von Oktober 1944 bis Februar 1945 im Hausgefängnis der Gestapo zugebracht. Dann wurde er für zwei Monate ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht und schließlich nach Flossenbürg verlegt, wo er am 9. April 1945 wegen Landes- und Hochverrats hingerichtet wurde. Angeregte Diskussion
In seinem Vortrag machte Wolfgang Huber die Wendungen deutlich, die der Blick auf das Leben Bonhoeffers durch die Jahrzehnte hindurch genommen hat. Zu seinen Lebzeiten und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Glaubenslebens Bonhoeffers mehr als kritisch gesehen. Seine politische Radikalität war nicht nur der Bekennenden Kirche der NS-Zeit zu viel, sondern wurde auch in der Zeit des gesellschaftlichen und kirchlichen Wiederaufbaus nach dem Krieg verschmäht. Die Bekennende Kirche wollte der Obrigkeit gehorsam sein, solange sie sich aus den Kircheninterna heraushielt. Die Unsicherheit der deutschen Kirchen und Theologie im Umgang Bonhoeffer nach dem Krieg hatte auch noch einen anderen Grund: Wer sich mit der Biografie dieses Mannes auseinandersetzt, wird mit der Schuld an den Juden und dem Thema des Holocaust konfrontiert.
Bonhoeffer blieb für lange Zeit ein Vaterlandsverräter, ein Abtrünninger, ein Stein des Anstoßes. Dieses Bild änderte sich erst erst Laufe der 1960er Jahre. Die Veröffentlichungen seiner Briefe und Schriften aus der Gefangenschaft durch Eberhard Bethge und das veränderte Bewusstsein eigener Schuld und Verantwortung für die Schoah und den Nationalsozialismus. In das Zentrum der Beachtung rückte der mutige Mann, der zweifelnde Mensch, der Verfolgte.
Die Theologie und Biografie Bonhoeffers bot Anknüpfungspunkte für progressive Weiterentwicklung in der evangelischen Kirche. Die Befreiungstheologien Süd- und Nordamerikas, der „andere Protestantismus“ Dorothee Sölles, überhaupt eine Theologie nach Ausschwitz, schienen ohne Bonhoeffer nicht möglich.
Heute erheben Christen gemeinsam mit Gläubigen anderer Religionen ihre Stimme für den Frieden. Ökumenisches Sprechen wird zur Pflicht, wo Krieg und Gewalt sich ausbreiten. Bonhoeffers authentische Existenz im Glauben, das christliche Zeugnis gegen den Nationalsozialismus und schließlich die Hingabe seines Lebens inspirieren Menschen, die sich gegen Gewalt und für die Menschenwürde einsetzen. Und wie viel Trost inmitten persönlicher Krisen spendet der berühmte Text von den guten Mächten, in dem Trauernde und Verzweifelte wunderbar geborgen sind. Im Angesicht des Todes fand Bonhoeffer die Kraft zu stillen und zuversichtlichen Zeilen – eindringlich und ergreifend.
Dem Vortrag Hubers folgte eine angeregte Diskussion mit dem Publikum zum theologischen und ethischen Denken Bonhoeffers. Er lehrt: Es braucht ein Fundament klarer ethischer Orientierungen. Sie müssen in authentischer, an Christus orientierter Frömmigkeit wurzeln und auf öffentliche Verantwortung zielen. Nur so können Christen den Herausforderungen der eigenen Zeit begegnen. Und zwar zuversichtlich. sis



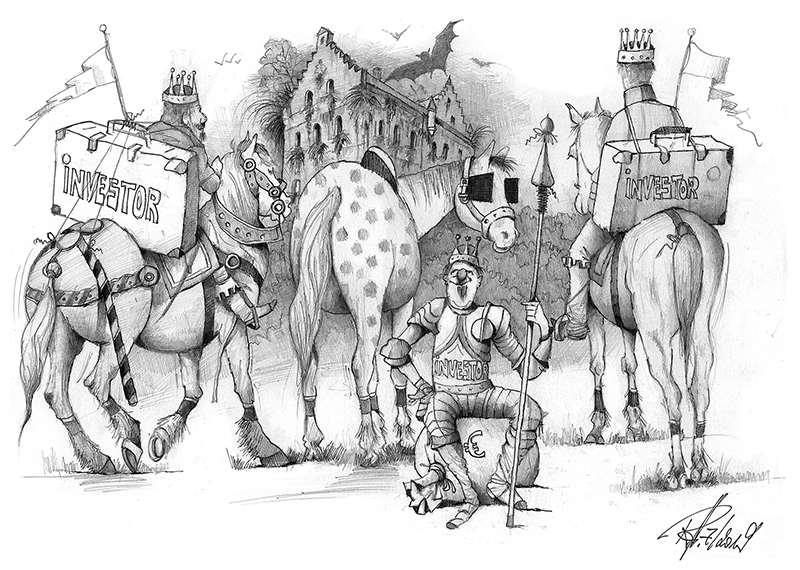
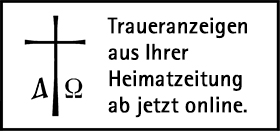

Schreibe einen Kommentar